Hybrides Publizieren: „Mehr Offenheit“
Simon Worthington befasst sich mit hybridem Publizieren beim Innovation Incubator der Leuphana Universität Lüneburg. Das von ihm gegründete Web- und Printmagazin Mute ist ein hybrides Konzept, das auch bei der Konferenz CONTEC (8. Oktober) in Frankfurt diskutiert werden wird. Ein Interview mit Simon Worthington darüber, was hybrides Publizieren leisten kann, warum die akademische Verlagswelt sich öffnen muss und was die Datenschnüffelei für innovative Webkommunikation bedeutet.
VOCER: Was bedeutet Publizieren für Sie in einer Ära, in der jeder publizieren kann, in dem er einen Tweet absetzt oder seinen Facebook-Status aktualisiert?
Simon Worthington: Wenn Publizieren bedeutet, etwas öffentlich zu äußern, dann kann das in der Tat jetzt jeder auf vielfältige Weise tun. Wenn man aber will, dass die Öffentlichkeit auch tatsächlich wahrnimmt, was der einzelne veröffentlicht, dann braucht man die gleichen Mechanismen, die es auch beim traditionellen Veröffentlichen über Verlage gab. Es geht immer noch wie in Büchern und Magazinen darum, die richtigen Worte zu finden, man muss sich konzentrieren.
Was macht akademisches Publizieren aus?
Es muss sich an die akademischen Konventionen halten – an das Zitatwesen und an definierte Ordnungen. Darüber hinaus hat sich das akademische Publizieren in eine Richtung entwickelt, dass es sich nur an definierte Zielgruppen und Peers richtet. Ich glaube, dass sich das gerade wandelt und es muss sich auch wandeln in Bezug auf seine Zielgruppen.

Foto: Sebastiaan ter Burg / Flickr, CC 2.0
Muss sich das akademische Publizieren stärker öffnen?
Ja, natürlich. Die Open Access Debatte hat hier einiges bewirkt. Die Bewegung kämpft seit über zehn Jahren für mehr Offenheit. Die Argumente sind finanzieller Natur und sie drehen sich auch um das öffentliche Interesse. Die Öffentlichkeit bezahlt die Inhalte und hat deshalb ein Recht auf freien Zugang. Es hat Vorzüge, wenn sich das Wissen um das, womit sich die Gelehrten beschäftigen, verbreitet. Es muss sich öffnen.
Wie hängt Ihr Konzept des hybriden Veröffentlichens mit akademischem Publizieren und Open Access zusammen?
Unsere Definition lautet: Hybrides Publizieren ist ein Weg, um der Komplexität der aktuellen Lage gerecht zu werden. Es geht nicht nur um neue Formate und darum, wer veröffentlichen kann, sondern auch um die fundamentalen Grundlagen des Publizierens. Es geht um Urheberrechte, ökonomische Modelle, Bildung und viele andere Bereiche, die sich verändern. Für uns bedeutet hybrides Publizieren, die roten Fäden in in diesem sehr komplexen Bild zu finden, das alles Bisherige auf den Kopf stellt.
Das klingt aber sehr abstrakt. Können Sie das anhand eines Wissenschaftlers, der ein Buch veröffentlicht, veranschaulichen? Wie würde das im Modell des hybriden Publizierens funktionieren?
Ein Beispiel wäre ein akademisches Buch, das von mehreren Autoren auf einer Plattform wie Liquid Books bei Open Humanities Press veröffentlicht wird. Nicht nur ist das Buch Open Access – es steht also frei im Netz – sondern es ist auch in einem Wiki editierbar, kann also verändert werden. Das Netz hat einige Funktionen des traditionellen akademischen Verlagswesens übernommen.
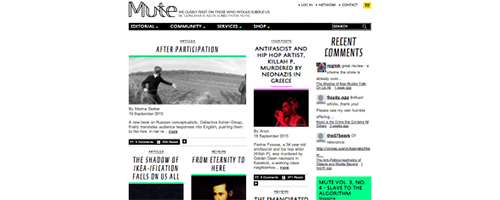
Inwiefern forciert Ihr Magazin Mute diese Ideen?
Wir haben Open Access als Modell schon 2005 angewandt. Es war eine Reaktion darauf, dass wir schon immer ein unabhängiges Magazin waren und gesehen haben, dass kulturelle und philosophische Ideen immer mehr im Netz geformt wurden. Jemand kann beispielsweise ein Thesenpapier auf einem Blog zur Diskussion stellen. Dieses offenen Ansatz haben wir für die Veröffentlichung unserer Magazinbeiträge übernommen. Es war aber auch eine Reaktion auf die wirtschaftlichen Bedingungen. Mute ist ein unabhängiges Magazin, das außerhalb des universitären Betriebs operiert. Unsere Autoren und Redakteure werden bezahlt. Wir wollten ein ökonomisches Modell finden, das einerseits Umsatz generiert, aber gleichzeitig so offen und maximal zugänglich wie möglich ist. Deshalb haben wir mit Open Access und ökonomischen Modellen experimentiert. Wir haben die Inhalte erst frei ins Netz gestellt, dann haben wir sie in einem späteren Stadium des Zyklus einer Magazinausgabe gedruckt und Abonnements verkauft. Es war und ist ein Experiment.
Das klingt, als ob Sie das akademische Publikationsmodell auf den Kopf gestellt hätten. Im traditionellen Modell bekommt der akademische Autor gar kein Honorar und dann verkauft der Verlag teure Abonnements an Bibliotheken …
Ja, wir haben mit diesem Modell insofern gebrochen, als Bibliotheken nicht für Publikationen bezahlen sollten, für die Autoren kein Geld bekommen haben.
Was ist die tiefere Bedeutung des Namens Mute?
Ich glaube, es steckt eine Frage darin. Das Netz hat inhärente Demokratisierungstendenzen. Es ist ein universales Veröffentlichungssystem. Jeder kann eine Stimme haben und wir sehen viele verschiedene Arten zu publizieren. Die Frage, die Mute aufwirft, ist: Es gibt dabei noch eine ganze Reihe weitere Faktoren. Es reicht nicht, Technologie anzuwenden, Talent und Erfahrung zählen ebenfalls.
Glauben Sie, dass Ihr Publikationsmodell von Technologie beeinflusst ist?
Ja, sehr stark sogar. Ich glaube sogar, man kann die gegenwärtige Liberalisierung, wer schreiben, lesen und veröffentlichen kann, mit der Revolution nach der Erfindung des Buchdrucks vergleichen. Wir wissen, dass diese Erfindung, Lesen Schreiben, Veröffentlichen und wie wir Wissen organisieren auf vielfältige Weise verändert hat. Die Technologie beeinflusst also, was wir unter Veröffentlichen verstehen.
Mute beschreibt seine Mission als „Kultur und Politik nach dem Netz erforschen“. Das ist erklärungsbedürftig. Inwiefern sind wir in einer „Nach dem Internet“-Phase?
Es ist keine Frage mehr, ob sich das Netz durchsetzen wird, es ist längst da. Aber was machen wir jetzt damit? Als wir uns diesen Claim im Jahr 2000 überlegten, war das das Netz noch eine offene Frage für die Menschen. Jetzt gilt es als selbstverständlich.
Ist das wirklich so in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit? Kanzlerin Angela Merkel hat, als Präsident Obama zuletzt Deutschland besuchte, eine vieldiskutierte Bemerkung gemacht: „Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Die allgemeine Reaktion war zunächst Verblüffung und dann die Erkenntnis, dass diese Aussage in vielerlei Hinsicht stimmt. Wir haben gerade erst angefangen, die Möglichkeiten des Netzes zu entdecken. Deshalb klingt es schon ziemlich avantgardistisch oder abgehoben, zu sagen, wir befinden uns in der Post-Web-Phase.
Merkel hat Recht. Wir kratzen gerade erst an der Oberfläche dieser neuen Lebenswelt. Aber sie ist da. Es gibt kein Zurück.
Mit allem, was wir wissen oder annehmen müssen – dass Regierungsbehörden die Mittel haben, unsere sämtliche Kommunikation im Netz zu überwachen – wie beeinflusst das kreatives Denken und vor allem radikale und nonkonformistische Ideen? Wird es es den freien Fluss der Informationen behindern?
Offensichtlich wird es zu einem gewissen Grad der Selbstzensur führen. Es ist nicht nur die Tatsache, dass alles mitgelesen werden kann. Die Menschen sind besorgt, dass sie in Schubladen gesteckt und Profile von ihnen angelegt werden. Und dass diese Profile fehlinterpretiert und ohne jede Rechenschaft gegen sie verwendet werden können. Es ist nicht, als ob man in der Presse falsch zitiert oder in einem politischen oder juristischen Verfahren angeklagt wird. Wir werden individuelle und institutionalisierte Selbstzensur sehen. Und das ist erst der Anfang.


