Mit eingezogenen Fühlern
Zur Eröffnung der diesjährigen Jahreskonferenz des Netzwerk Recherche sprach die Reporterin Julia Friedrichs über die Lage des Journalismus. VOCER dokumentiert ihre Rede in leicht gekürzter Form.
Ich bin 32 Jahre alt. Über meinen Weg in diesen Beruf könnte ich das gleiche erzählen wie vermutlich die meisten Journalisten: Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich war 17 und ich verliebte mich im Münsterland. In Gronau, einem Ort, der jungen Menschen wenig Anlass für große Träume lässt.
Aber da war die Zeitung. Drei Räume mit vier Redakteuren, die mich nach und nach immer mehr schreiben ließen. Ich durfte in den Rat und zu Rektoren, zu Seniorenabenden und zu Schützenfesten. Und wenn Sie jetzt denken: „Schützenfest, oh je!“, dann haben sie noch keinen Kleinkunstabend in einer Kleinstadtaula erlebt. Aber all das, was klingt wie ein abschreckendes Lokalzeitungs-Klischee fand ich, verknallt in das, was ich tat, toll. Auch Senioren und Schützen haben spannende Geschichten zu erzählen. Von Ehen, die 60 Jahre halten, und von Gewehren, die im Keller lagern. Sonntags früh dann, der wöchentliche Gang in die Redaktion. In diese bald bekannte Welt der Redakteure, die Zeit hatten oder sich Zeit nahmen, jeden Text gründlich zu redigieren. Und am Montag dann die Berichte in der Zeitung. Das Gefühl, eine Stimme zu haben, die jemand hört oder besser liest.
Kurz darauf ergab sich genau daraus die Gelegenheit, diese Stadt verlassen zu dürfen. Etwas, was ich meiner ersten großen Liebe nie vergessen werde.
Wie viele habe ich dann studiert, volontiert und schon vor dem Abschluss angefangen richtig zu arbeiten. Filme zu drehen, Radio zu machen, weiter Texte zu schreiben.
Aber ich vermute, an diesem Punkt enden die Gemeinsamkeiten, zumindest mit einem Teil hier im Saal. Mit denen, die schon etwas länger dabei sind. Denn es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass ich mich mit dem Journalismus in einen verliebt hatte, dem es nicht gerade gut ging.
Im Oktober 1999 begrüßte ein Professor mich und 50 weitere Erstsemester und versprach uns eine goldene Zukunft. Es war das letzte Mal, dass ich jemanden so etwas sagen hörte. Das Institut hätte einen erstklassigen Ruf, meinte er. 96 Prozent der Absolventen würden unmittelbar nach dem Studium eine Redakteursanstellung finden und somit einen ordentlich bezahlten, sicheren Job.
Wir hatten gerade die Mappen mit den ersten selbst moderierten Sendungen im Uni-Radio und den Übungsmeldungen abgegeben, als 2001 das über uns hereinbrach, was als „Erste Medienkrise“ der Auftakt eines ganzen Krisenreigens war. Wir lernten schnell, dass auch Professoren unrecht haben.
Der Speck ist weg
Bei manchen Verlagen, sagt der Medienforscher Horst Röper, sei damals der Speck weggefallen, den sie sich angefuttert hatten. Das sagte er 2008 zu Beginn der zweiten großen Medienkrise. Und er fügte an: „Jetzt gibt es keinen Speck mehr.“
Trotzdem kam die nächste Sparrunde. Von vielen Verlagsmanagern wurde diese als eine Art Naturereignis beschrieben: „Die See wird rauer“, begründete Bodo Hombach die Kürzungen bei der „WAZ“. Und Bernd Buchholz, der Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr, steuerte zu dieser Meer-Methaper seinen bekannten Sonnendeck-Ausspruch bei: „Wenn Sie als Kapitän auf der Brücke stehen und eine Riesenwelle aufs Schiff zukommen sehen, dann müssen Sie den Leuten auf dem Sonnendeck sagen, dass sie ihre Liegestühle und Drinks beiseite stellen müssen.“
Ich will Sie jetzt nicht mit einer Rückschau auf zehn Jahre Medienkrise quälen. Ich will Ihnen nur ein Gefühl dafür geben, wie es war, in dieser Zeit mit dem Beruf zu beginnen. Zehn Jahre begleitet von einem Krisenrauschen.
Die goldenen Zeiten des Journalismus habe ich nicht mehr erlebt. Manchmal erzählen Menschen, die dabei waren, davon. Von Sonnendecks habe ich zwar noch niemanden sprechen hören, aber von Business-Class-Flügen, horrenden Spesenrechnungen, tagelangen Vorbesichtungen mit touristischem Schwerpunkt. Das ist aus gutem Grund vorbei. Es mag notwendig gewesen sein, Journalisten klar zu machen, dass Inhalte auch verkauft werden müssen. Es mag nötig gewesen sein, ihnen Wahrheiten beizubringen, wie sie Giovanni di Lorenzo lehrte: „Ohne ein profitables Unternehmen wird es keinen Qualitätsjournalismus geben“, sagte er.
Hoffen auf den „Recall“
Ja. Journalismus ist auch ein Wirtschaftsgut. Diese Botschaft haben wir inhaliert. Diese Botschaft prägte wie keine zweite unser bisheriges Berufsleben. Sie hat uns und das, was wir tun, verändert. Da ist zum einen das Geld. Viele, vor allem viele Junge, haben gelernt, bescheiden zu sein.
Es war einmal normal, nach einem Volontariat als Redakteur unbefristet übernommen zu werden. Manche werden sich daran erinnern. Diese Sicherheit ist Vergangenheit. Trotz Studium, trotz Volontariat: Die Gegenwart vieler Jungjournalisten ist prekär.
Da werden Befristungen an Befristungen gehängt, Junior-Redakteursverträge mit Dumping-Gehalt abgeschlossen, Pauschalisten statt Redakteure eingekauft. Da werden Volontäre nach der Ausbildung bei verlagseigenen Subunternehmen angestellt, um sie dann als Leihredakteure anzuheuern. Andere bleiben gleich ganz bei outgesourcten Content-Büros und liefern Seiten am Fließband. Viele in der Hoffnung, irgendwann doch noch einmal in der echten Redaktion landen zu können. Dauer-Casting. Ständiger Wettbewerb. Die permanente Angst zu versagen, auszuscheiden, es nicht einmal in den „Recall“ zu schaffen. So beschrieb die Journalistin Nina Pauer, gerade 30 geworden, dieses Lebensgefühl. Nein, das mit den 96 Prozent in lebenslanger Festanstellung – das hat nun wirklich nicht geklappt.
Aber was soll’s. Wir sind flexibel. Und Redaktionen ohne Redakteure müssten eigentlich ein hervorragender Arbeitgeber für gut ausgebildete freie Journalisten sein. Aber leider haben die Verlage kein Geld umgeschichtet, sondern eben eingespart. Den Speck und das Fleisch und langsam auch die Knochen, die noch tragen. Die Honorare der Freien sind nach Schätzungen des DJV von 1998 bis 2008 inflationsbereinigt um 30 Prozent gesunken. Fast 40 Prozent der freien Journalisten verdienten 2008 weniger als 1000 Euro brutto im Monat. Dass das ganz schön wenig ist, räumen auch manche der Verantwortlichen ein: Der Chefredakteur des Tagesspiegels sagte: Der Tageszeitungsjournalismus sei nicht geeignet, Freien einen Lebensunterhalt zu ermöglichen. Und Giovanni di Lorenzo meinte: „Ich wünschte, wir hätten die Reserven, um die Freien besser zu bezahlen, aber ich glaube, dass man das Schreiben für „Die Zeit“ auch als Investition in die eigene Laufbahn betrachten sollte.“
Von Ehre allein kann nur niemand leben. Glücklicherweise zahlt die „Zeit“ meine Artikel in Euro. Und meines Wissens wird auch Giovanni di Lorenzo in dieser Währung bezahlt.
Studiert, volontiert, unterbezahlt
Was das alles konkret bedeutet? Drei Skizzen aus der Gegenwart:
Ein Freund hat im Auftrag einer überregionalen Zeitung ein aufwändiges Portrait recherchiert. Mehrere Schauplätze, mehrere Interviewpartner, mehrere Wochen Arbeit. Die Geschichte füllte eine Seite. Das Honorar: 400 Euro. Die Spesen musste er selber tragen.
Ein anderer Freund hat Anfang des Jahres die Redaktionsleitung einer kleinen, renommierten Fachzeitschrift übernommen. Er sollte dort einen Tag pro Woche auf Werkvertragsbasis arbeiten. Er verhandelte einen Tagessatz von knapp 240 Euro brutto. Klingt viel, ist aber nach Einschätzung der Gewerkschaften noch nicht einmal die Summe, die nötig ist, um als Freier netto ein Redakteursgehalt zu erreichen. Am Ende arbeitete er statt abgemachter acht Stunden pro Woche 18. Das halbierte den Tagessatz.
Eine Freundin arbeitet bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender. Sie hat studiert, volontiert, mehrere Jahre Berufserfahrung, leitet Projekte in den Redaktionen des Senders. Ihr Tagessatz: 190 Euro. Und damit gehört sie zu den gut bezahlten. Jüngere Kollegen liegen bei 130, 140 Euro. Tariflich vereinbarte Sonntags- und Feiertagszuschläge gäbe es für Freie wie sie nicht, sagte ihr die Chefin. Erst nach Protesten bei der Personalabteilung zahlte der Sender dann doch.
Und uns hier in Deutschland, das muss man dazu sagen, geht es noch gut: Ich habe ein halbes Jahr Journalismus in Brüssel studiert. Gemeinsam mit anderen Europäern – die meisten bereits hatten eine Ausbildung an einer Journalistenschule hinter sich. Die meisten waren wenigstens dreisprachig. Genützt hat ihnen das nicht.
Die Spanierin Gema arbeitet jetzt in der Verwaltung. Rosa ist Musiklehrerin geworden. Und der Belgier Francois hat eine Banklehre gemacht. Sie alle wollten Journalisten werden. Sie alle konnten von diesem Beruf nicht leben.
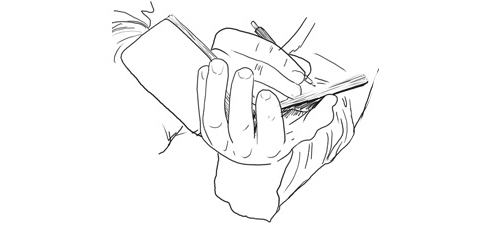
Pech gehabt, könnte man jetzt sagen. Das Casting nicht geschafft. Nicht gut genug gewesen. Und so denken viele Junge ja auch. Sie haben gelernt, die Schuld zuallererst bei sich zu suchen. Viele rüsten dann auf: Noch ein Praktikum. Noch eine Summer School. Noch einen Master.
Der Soziologe Heinz Bude beschreibt in seinem Buch „Bildungspanik“ (hier ein Auszug als PDF) das Perfide dieses Wettstreits. Wenn wir Jungen ständig mehr Qualifikationen aufhäufen, werden trotzdem nicht alle bessere Chancen haben – nur der Stress, der nimmt für alle zu. „Wenn alle im Stadion aufstehen, um eine bessere Sicht zu haben“, schreibt Bude, „sieht niemand besser als wenn alle sitzen blieben“.
Man muss sich das Journalistsein leisten können
Gestatten Sie mir noch einen kleinen Schlenker: Es gibt einen weiteren Grund, aus dem ich diesen Bildungswettstreit mit schlechter Rendite problematisch finde: Schon jetzt ist der Journalismus ein Berufsfeld, in das die obere Mittelschicht strebt. Kinder, deren Eltern im Notfall auch mal Miete und Essen zahlen können, wenn es für das Praktikum des Sohnes wieder nichts gibt. Kinder, deren Eltern Monat für Monat stillschweigend Geld überweisen können, weil sie wissen, dass die Tagessätze, die die Tochter als Pauschalistin bekommt, zum Leben nicht reichen. Es wäre fatal, wenn sich jemand, der solche Eltern nicht hat, den Journalismus nicht mehr leisten könnte. Auch weil deren Perspektive auf die Welt dann fehlen würde.
Ja. Journalismus ist auch ein Wirtschaftsgut. Wenn ich sage, dass dieser Gedanke unser Arbeitsleben prägt wie kein anderer, dann meine ich nicht nur die Bezahlung.
Das zweite, was wir gelernt haben, ist, den Erfolg unserer Arbeit vor allem in wirtschaftlichen Kriterien zu messen. Wie alle Autoren, die ich kenne, verfolge ich permanent den Verkaufsrang meiner Bücher bei Amazon. Sind die Verkaufszahlen gut, schickt mir der Verlag sie aufs Handy. Wenn lange keine SMS kommt, heißt das nichts Gutes. Wenn eine meiner Dokumentationen im Fernsehen ausgestrahlt wurde, warte ich am nächsten Morgen nervös auf die Mail um neun Uhr. Die Mail mit den Minutenverläufen, den Umschaltpunkten und am Ende: der Zahl. Die Quote, in deren Takt der Sender tickt. Die Zahl, die Sendungen unangreifbar macht, wenn sie nur hoch genug ist. Die sie schwächt, wenn sie zu niedrig ist, wenn sie unter der „Benchmark“ liegt.
Klickraten, Quoten, Verkaufsauflagen.
Zumindest eine meiner Gehirnhälften hat sich diesen Zahlen bereits vollständig unterworfen. Es mag nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch die andere nicht mehr darauf beharrt, dass nichts davon ein tauglicher Maßstab für Qualität und Relevanz ist.
„Wir haben einfach verpennt, dass aus unseren Artikeln und Filmen ‚Produkte’ oder ‚Stücke’ wurden, aus dem Kulturgut Journalismus ein Wirtschaftsgut namens ‚content’„, sagte Sonia Mikich, Leiterin der Inlandsredaktionen des WDR. „Wir machten es uns gemütlich, als ‚benchmarking’, ‚audience-flow“, ,controlling’, ,usabilty’, ,look and feel’, ,performance’ in unserem Handwerkskasten auftauchten und die ,tools’ eines angesagten Superprofessionalismus wurden. Als hätten wir ’nen kleinen McKinsey im Ohr, lernten wir Neusprech.“
Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele ihren McKinsey ähnlich wie ich nicht nur im Ohr, sondern inzwischen auch im Hirn haben. Eine ganz neue Form des inneren Zensors.
Das „bisherige“ Kerngeschäft
Und noch eine dritte Lektion folgte für uns aus dem Prinzip „Journalismus als Wirtschaftsgut“.
Wir haben gelernt, dass es einen starken Konkurrenten gibt, der einfach mehr Geld hat. Inzwischen gibt es wohl mehr Public-Relations-Arbeiter als Journalisten. Hochschulen, die Journalisten und PR-Schaffende gemeinsam ausbilden, begründen dies damit, dass sie ihre Absolventen marktfähig machen wollen. Journalist ist das, was man gerne wäre. PR ist das, was einen letztendlich ernährt, ist die Botschaft, die dahintersteht. Eine Botschaft, die nicht nur diese Hochschulen senden.
Fast alle großen Verlage haben sich inzwischen eine Corporate-Publishing-Sparte zugelegt. Redaktionen, die im Auftrag von Unternehmen Hefte produzieren. Bernd Buchholz sagte im Gespräch mit der „Zeit“: Der Journalismus sei für ihn nur das „bisherige Kerngeschäft.“ Und fügte hinzu: „Das ist der natürliche Lebenszyklus von Märkten. Hier geht es runter, dort geht es rauf“. Um dann den Zustand seiner Branche mit den Worten zu kommentieren: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.“
Wer mit jungen Journalisten über das Verhältnis von PR und Journalismus spricht, der merkt schnell, dass auch viele hinter diese Lektion einen Haken gesetzt haben: Verstanden und akzeptiert.
Ich glaube eine gravierende Deformation, die das Erwachsenwerden in der journalistischen Dauerkrise verursachen kann, ist noch unerwähnt geblieben. Vielleicht aber ist sie die wesentliche. Da sie das beschädigt, was für Journalisten so elementar ist: die aufrechte Haltung.
Wer immer und immer wieder hört: „Die See ist rau! Die Zeiten hart! Pass Dich an!“, dem wird es schwerfallen, die Ideale mit denen er mal gestartet ist, zu bewahren. Die Träume. Die Prinzipien. Das, was anständiger Journalismus auch braucht.
Kriechend durch die Arbeitswelt
Theodor Adorno, der gerne mit Tiermetaphern hantierte, erzählte die Geschichte der Schnecke. Die Schnecke ist neugierig auf die Welt, sie will erfahren, will erleben und reckt ihr Fühlhorn hinaus. Wie dieses sei auch der menschliche Geist zu Beginn jedes Lebens, meint Adorno. Wenn die Schnecke aber aus der Richtung, die sie reizt, einen Schlag auf den Fühler bekommt, wird sie ihn einziehen. Und diesen Bereich der Welt meiden. Sie wird es weiter versuchen, die Fühler in zwei, drei andere Richtungen ausstrecken. Aber jeder Schlag wird ihr einen Teil der Welt vermiesen. „Solcher erste tastende Blick ist immer leicht zu brechen“, schreibt Adorno, „hinter ihm steht der gute Wille, die fragile Hoffnung, aber keine konstante Energie. Das Tier wird in der Richtung, aus der es endgültig verscheucht wird, scheu und dumm.“
Aus meiner Sicht ist das der verheerendste Schaden, den die Medienkrise angerichtet hat: dass der Nachwuchs mit eingezogenen Fühlern durch die Arbeitswelt kriecht.
Spricht man mit Ausbildern, fallen einige Vokabeln immer wieder: Verzagt seien viele Berufsanfänger. Ängstlich. Bescheiden. Aber auch: Bereits, fast alles mitzumachen. Zu funktionieren.
Einer, der seit über zehn Jahren Journalismus lehrt, meint, inzwischen näherten sich viele Nachwuchsjournalisten diesem Beruf „mit jener latent depressiven Grundstimmung, die man Tag für Tag mit ihnen einübt.“ Ein anderer Ausbilder formulierte es drastischer: „Wenn ich meinen Nachwuchsjournalisten sage, springt aus dem zehnten Stock und schreibt dann eine Reportage darüber, dann machen die das.“ Natürlich wäre es dämlich zu springen. Aber ist es nicht verwerflicher, den Sprung in Auftrag zu geben?
Wem also ist der größere Vorwurf zu machen? Den jungen Journalisten, die bereit sind, alles zu tun, um einen Fuß in die Redaktionen zu bekommen? Oder denen, die genau das ausnutzen?
Eine beängstigende Wiederholung
Es ist ungehörig, Gehälter und Honorare zu drücken. Wer frei berichten will, muss wissen, dass er auf Dauer davon leben kann. Es ist erniedrigend, den Erfolg von journalistischer Recherche nur in Marktzahlen zu messen. Und es ist gefährlich, wenn die Grenze zwischen Journalismus und Public Relations nicht mehr unverrückbar steht.
Aber trotzdem habe ich lange überlegt, ob ich diese berechtigte Klage noch einmal führen sollte. Sie ist notwendig, aber ihre Wiederholung macht mir auch Angst.
Es ist die Angst, dass auch dies kein Text sein wird, der ermuntert, dass vor lauter Lamento irgendwann etwas Wertvolles verloren gehen könnte und ich wie viele die faszinierenden Seiten dessen, in den ich mich damals verliebte nicht mehr sehen werde.
Darum in aller Deutlichkeit: Es ist trotz allem ein großes Glück, als Journalist arbeiten zu dürfen.
Wir dürfen die Welt in Formen gießen. In Berichte und Reportagen, in Moderationen und Kommentare, in Analysen und Essays. In all das, was so viel mehr ist als Content.
Wer will, dass ich was glaube und warum? Wer den Zuschauern, den Lesern hilft, diese Frage zu beantworten, der dient der Demokratie, der macht manchmal Menschen sogar klüger, mündiger, glücklicher.
Vom Glück einer Journalistin
In einer Welt, in der fast alle die Geschehnisse nur vermittelt konsumieren, dürfen wir dabei sein. In den letzten Jahren war ich in Wohnungen von Hartz-IV-Empfängern und in Bürobauten in Steueroasen. Ich habe die Waffensammlungen von Großkaliberschützen gesehen und erlebt, welche seelischen Wunden, diese Waffen bei den Angehörigen der Opfer von Amokläufen verursachten. „Wer erst mal abtaucht in die Wirklichkeit, wer sich hineinfallen lässt, wird immer mit dem Schatz zurückkehren, der sich Wahrheit nennt“, beschreibt Mathias Werth, Redaktionsleiter der „die story“ im WDR diese Art der Recherche.
Wir dürfen im Prinzip jeden alles fragen. In den letzten Jahren war ich im Büro von Peter Hartz, der mir erzählte, warum er sich gern in die Rolle des Alleinherrschers träumt; und ich war bei denen, die vor einem Leben als Hartz-IVler nach Frankreich geflohen waren, weil sie von den Ideen solcher Alleinherrscher wenig hielten. Ich konnte Konzern-Sprecher fragen, warum man Leiharbeitern keine Umkleideräume gewährt und Leiharbeiter, warum sie sich das gefallen lassen. Und ich durfte, das war für mich fast die größte Sensation: In Schulen endlich die Schwelle zum Lehrerzimmer überschreiten und die Rollen umkehren: Ich frage. Die antworten.
Wir Journalisten dürfen das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Das Interessante vom Belanglosen. Wir dürfen dabei unsere Rolle recht frei interpretieren. Wir müssen nicht immer mitmachen. Wir dürfen widersprechen. Mindermeinungen vertreten. Am Rande stehen. Sonderbar sein.
Ein bisschen mehr Pathos
Könnte es einen großartigeren Beruf geben? – Ein bisschen viel Pathos, mögen Sie jetzt denken. Und sicher Recht haben.
Aber ein bisschen mehr Pathos wünsche ich mir oft, wenn ich älteren, abgeklärten, manchmal zynischen Kollegen lausche. Ein bisschen mehr Pathos täte auch uns, die wir nachfolgen, ganz gut.
Es gibt etwas zu verteidigen. Und wir Jungen können keinen größeren Fehler machen, als vor lauter Verzagtheit diese Verteidigung zu verweigern. Auch wenn viele Verlagsmanager die Naturgewalten bemühen, um Kürzungen zu rechtfertigen. Der Journalismus, den wir vorfinden, und der, der in Zukunft sein wird, ist keineswegs naturgegeben. Wir alle prägen ihn. Jeden Tag. Auch wir Jungen können „Nein“ sagen, zu Dingen, die wir nicht wollen. Wir können Rabatte und PR-Verträge ablehnen, um unsere Unabhängigkeit zu bewahren. Wir können rausgehen, Menschen treffen, denen niemand zuhört, und ihre Geschichten erzählen. Wir können Missstände recherchieren. Kritik üben. Wir können große Fragen stellen. Noch immer, so ist meine Erfahrung, werden wir dann auch Zuhörer finden. Und auch das journalistische Leben ohne feste Redakteurstelle ist lebenswert. Es muss nicht, wie oft suggeriert, zweite Wahl sein. Es kann tatsächliche Freiheit bedeuten. Freiheit von Konferenzen, Freiheit die Aufgaben selbst zu wählen, frei die Zeit dosieren zu können, zum Nachdenken, zum Lesen, zum Recherchieren. Freiheit muss also nichts Schlechtes sein. Auch diese Nachricht könnten wir nach außen tragen.
Aber Sie, die schon etwas länger dabei sind, sie müssten uns bei alldem ein wenig helfen. Streichen Sie das Wort „Haltung“ aus Ihren Sonntagsreden und zeigen Sie uns während der Woche, was dieser viel bemühte Begriff tatsächlich bedeutet. Seien Sie Vorbild. Ohne journalistische Vorbilder ist es verdammt schwierig, die viel verlangte Haltung einzunehmen. Ohne journalistische Grundsätze, wie es mir zum Beispiel das lang umkämpfte Gebot des Netzwerk Recherche „Journalisten machen keine PR“ war, ist es hart, Orientierung zu finden. Das Wichtigste aber zuletzt: Vergessen Sie bitte nicht, den Idealismus der Jungen zu bewahren. Hören Sie auf, uns immer und immer wieder auf die euphorisch ausgestreckten Fühler zu tappen. Ja. Journalismus ist auch ein Wirtschaftsgut. Das haben wir verstanden. Zeigen Sie uns, dass unabhängiger Journalismus im Kern viel mehr ist als das. Ein Kulturgut. Notwendig für die Demokratie. Grundgesetzgeschützt. In vielen Ländern so hart umkämpft, bei uns zum Glück erfolgreich errungen.
Ich bin 32 Jahre alt. Wenn alles gut geht, werde ich noch drei Jahrzehnte lang als Journalistin arbeiten. Müssen werden manche sagen. Dürfen, finde ich. Und hoffe inständig, dass das so bleibt.


